Emotionale Störung – Trennungsangst bei Kindern

Eine Trennungsangst ist bis zu einem gewissen Grad normal und auch wichtig. Problematisch wird es jedoch, wenn die Angst die Überhand gewinnt und das Kind gar nicht mehr ohne ihre Bezugspersonen an einem Ort sein können. In einem solchen Fall kommt es zu einer Trennungsangsterkrankung, die zu den emotionalen Störungen des Kindesalters gehört.
Lesen Sie hier mehr über die Ursachen und die Behandlungsmöglichkeiten dieser ernst zu nehmenden emotionalen Störung und mit welchen Strategien Sie die Trennungsangst überwinden können.
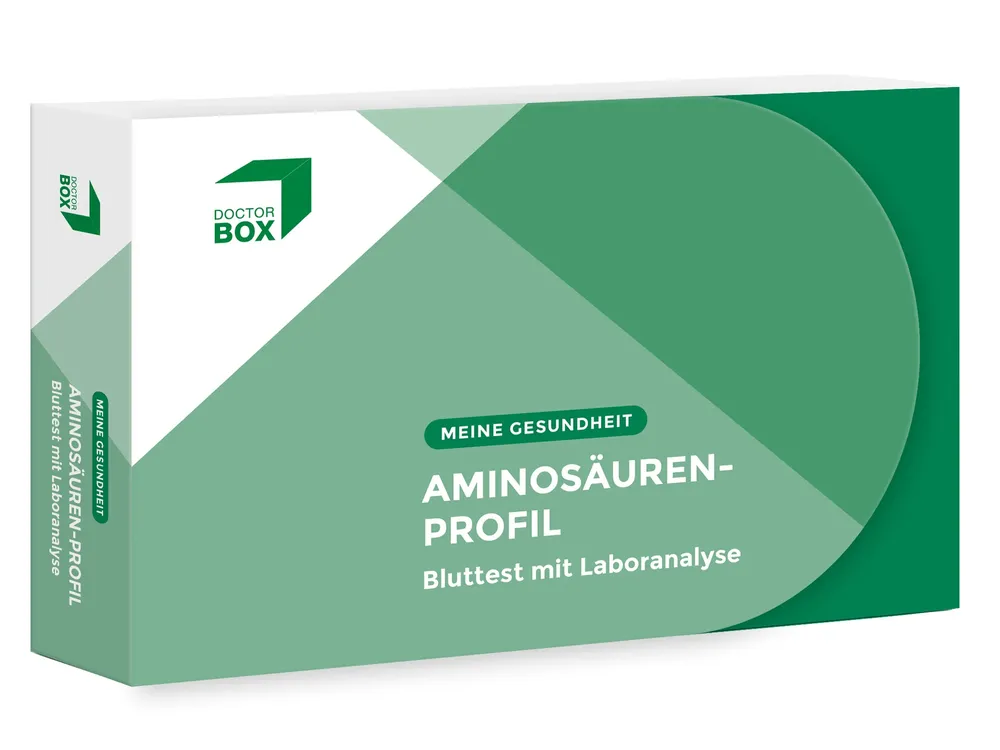
Das passiert bei der emotionalen Störung mit Trennungsangst
Trennungsängste sind im Grunde ein gewöhnlicher Bestandteil einer normalen Kindesentwicklung. Bei kleinen Kindern entsteht eine große Angst, dass sie von ihrer Mama oder ihrem Papa getrennt werden könnten.
Im Allgemeinen machen sich die ersten Trennungsängste ungefähr im 8. Lebensmonat bemerkbar. Am intensivsten sind sie jedoch zwischen dem 10. sowie dem 18. Lebensmonat. Die große Furcht lässt sich vor allem dann beobachten, wenn Eltern oder Erstbezugspersonen nicht in der Nähe sind. Eine erhöhte Ängstlichkeit der Kleinen zeigt sich aber auch dann, wenn bislang unbekannte Orte besucht werden oder wenn fremde Menschen auftauchen.
Die Kleinen fühlen sich bedroht, unwohl und unsicher, wenn sie nicht in den heimischen vier Wänden sind. Um hier eine innere Sicherheit und Ruhe für sich selbst aufzubauen, suchen sie dann den Augenkontakt mit den Eltern oder Bezugspersonen.
Wenn die Kleinen zu weinen beginnen, sobald Mama und Papa den Raum verlassen, ist das auf keinen Fall ein Hinweis auf eine „falsche Erziehung“ oder „ein verwöhntes Kind“. Vielmehr ist das Weinen ein Hinweis darauf, dass es dem Kind gelungen ist, eine gute Beziehung zu den eigenen Eltern bzw. anderen nahen Bezugspersonen aufzubauen. Das Weinen ist in solchen Lebenssituationen also eine positive kindliche Reaktion.
Im Lebensalter zwischen 8. und 18. Monaten können Eltern versuchen, sogenannte „Guck-guck-Spiele“ mit ihrem kleinen Schatz zu spielen. Dadurch können die Kleinen auf eine spielerische Art und Weise erlernen, dass die Eltern nicht für immer verschwunden sind, nur weil sie für eine gewisse Zeitspanne nicht zu sehen sind.
In diesem Zusammenhang sprechen Psychologinnen und Psychologen von der „Objekt- oder Personenpermanenz“: Dieser Begriff bezeichnet die kognitive Fähigkeit des Kindes zu verstehen, dass ein bestimmter Gegenstand oder ein Mensch auch dann weiterhin existiert, wenn er sich außerhalb des Wahrnehmungsfeldes befindet, das heißt, wenn der Gegenstand bzw. die Person weder sichtbar noch hörbar ist. Geprägt wurde dieser Begriff von dem Schweizer Entwicklungspsychologen Jean Piaget.
Trennungsängste bleiben in der Regel bis zum 2. Lebensjahr eines Kindes bestehen. In diesem Alter haben die Kleinen für gewöhnlich die Objekt- und Personenpermanenz erlernt und ausreichend Vertrauen zu ihrem Umfeld sowie zu ihren Bezugspersonen aufgebaut. Sie wissen, dass sie sich sicher sein dürfen, dass ihre Eltern bzw. Bezugspersonen auch wieder zurückkommen werden.
Trennungsangst – der Schritt von der Normalität hin zu einer emotionalen Störung
Im Allgemeinen sind Trennungsängste kein Anlass zur Sorge. Die meisten Kinder haben Trennungsangst, doch mit zunehmendem Lebensalter verliert sich diese. Es bedarf im Regelfall also keiner ärztlichen Untersuchung oder Behandlung.
Normale Trennungsängste müssen jedoch klar abgegrenzt werden von einer Trennungsangsterkrankung, die zu den sogenannten emotionalen Störungen des Kindesalters gehört. Diese zeigt sich vor allem bei älteren Kindern, so etwa im Vorschul- oder Schulalter, die noch immer nicht in der Lage sind, ohne ihre Bezugspersonen auszukommen. Die betroffenen Kinder weigern sich nicht selten, in den Kindergarten oder in die Schule zu gehen. Bei einer sehr stark ausgeprägten Angst kann sogar die normale kindliche Entwicklung negativ beeinflusst werden.
In einem solchen Fall wird die Trennungsangst bedenklich und entwickelt sich zu einer emotionalen Störung. Unter Umständen braucht es hier rechtzeitig die professionelle Unterstützung eines Kinderpsychotherapeuten.
Gelingt es den Kleinen am Vorschul-, Kindergarten- oder Schulprogramm teilzunehmen und nimmt die Angst mit der Zeit immer mehr ab, ist die anfängliche Angst kein Ausdruck einer Emotionsstörung. Wenn die Angst aber so stark ist, dass das betroffene Kind überhaupt nicht mit anderen Gleichaltrigen spielen oder in der Erziehungseinrichtung bleiben möchte, braucht es professionelle Unterstützung.
Eltern müssen in einem solchen Fall besonders auf ihr Verhalten achten und nicht durch falsche Reaktionen die Trennungsangst des Kindes noch weiter verstärken. Dazu kann es beispielsweise kommen, wenn Eltern ihre eigenen Aktivitäten einschränken oder sogar aufgeben.
Im ICD-10, dem internationalen Krankheitsverzeichnis, findet sich die Trennungsangst bei Kindern im Kapitel „Emotionale Störungen des Kindesalters“ unter der Nummer F93.0.
Trennungsangst oder Fremdeln?
Fremdelnde Kinder weinen manchmal, wenn sich ihnen eine unbekannte Person nähert. Ein solches Verhalten ist normal, wenn es ungefähr zwischen dem achten und dem neunten Lebensmonat auftritt und bis zum zweiten Lebensjahr wieder aufhört. Der Säugling erlernt schrittweise, bekannte Menschen von unbekannten zu unterscheiden: So entsteht das Fremdeln. Wie stark das Fremdeln ausgeprägt ist, unterscheidet sich von einem Kind zum nächsten.
Einige Säuglinge und kleine Kinder zeigen durch ihr Verhalten beispielsweise eine besondere Präferenz für ein Elternteil. Andere wiederum betrachten manchmal die Großeltern als Fremde. In einem solchen Fall sollten die Eltern die Großmutter und den Großvater einfach über das Fremdeln informieren, um eine Fehlinterpretation des kindlichen Verhaltens zu vermeiden. Hier braucht es keine ärztliche Intervention!
Erst ein stark ausgeprägtes fremdelndes Verhalten, das auch über eine längere Zeitspanne bestehen bleibt, kann ein Anzeichen für eine ernsthafte Störung sein. In einem solchen Fall ist ein Arztbesuch unumgänglich. Die Familiensituation, die Erziehungsmethoden und der emotionale Allgemeinzustand des Kindes sollten dann professionell begutachtet werden.
Wie entwickeln sich Kinder mit Trennungsangst?
Sensible, empfindsame und sehr schüchterne Kinder, die bereits als kleine Babys stark gefremdelt haben, sind besonders gefährdet, Trennungsängste zu entwickeln. Auch unsichere zwischenmenschliche Bindungen gelten als Risikofaktor. Eine rechtzeitige Verhaltenstherapie kann hier sehr wirkungsvoll sein und ist auch sehr wichtig. Kindliche Trennungsängste stehen nämlich im Verdacht, später im Erwachsenenalter die Entwicklung von psychischen Krankheiten zu begünstigen. Ängstliche Kinder sollen als Erwachsene vor allem zu Angststörungen und Depressionen neigen.
Symptome
Gerade Kinder, die unter einer Trennungsangsterkrankung leiden, empfinden es als starken Stress, wenn sie sich nicht in der gewohnten Wohnumgebung befinden oder die Bezugspersonen nicht vor Ort sind. Abschiede sind im Allgemeinen sehr schmerzhaft, und zwar sowohl für die Kinder wie auch für die Eltern. Die Kleinen weinen herzzerreißend und bitten Mutter oder Vater ganz verzweifelt nicht zu gehen. Auf diese Weise wird die Trennung aber für beide Seiten nur noch schwieriger.
Sind die Eltern innerlich angespannt, kann das die kindlichen Ängste noch zusätzlich intensivieren: Ein Teufelskreis!
Sobald die Eltern aus dem Wahrnehmungsfeld verschwunden sind, hat das Kind nur noch einen einzigen Gedanken im Kopf, nämlich wann Mama und Papa wieder zurückkommen. Es muss immer wissen, wo sich seine Bezugspersonen aufhalten.
Darüber hinaus machen sich die Kleinen oftmals übermäßig große Sorgen, dass einem oder auch beiden Elternteilen etwas zustoßen könnte, beispielsweise durch einen Unfall, Krankheit oder Tod.
Kinder mit einer solchen Trennungsangst verlassen ihre gewohnte und sichere Umgebung nur mit sehr großem Unbehagen. Manchmal weigern sie sich auch, an Klassenfahrten teilzunehmen oder im Ferienlager mit anderen Kindern Zeit zu verbringen. Sie möchten nicht wirklich Freunde in deren zuhause besuchen, geschweige denn bei ihnen übernachten.
Einige Kinder schaffen es auch nicht, allein in einem Raum zu bleiben: Die Kleinen beginnen daraufhin, sich an die Eltern zu klammern oder ihnen bei jedem Schritt, selbst wenn dieser nur im Haus ist zu folgen.
Auch Schwierigkeiten beim Zubettgehen sind keine Seltenheit. So können Kinder, die unter einer Trennungsangsterkrankung leiden, sich dauerhaft weigern, in Abwesenheit der gewohnten Bezugsperson ins Bett zu gehen. Einige der Betroffenen werden auch von Albträumen geplagt, dass beispielsweise die gesamte Familie durch eine Naturkatastrophe ausgelöscht werden könnte.
Hinzu gesellen sich häufig noch körperliche Symptome wie zum Beispiel Bauch- oder Kopfschmerzen. Das Kind äußerst meist keine Verhaltensauffälligkeiten, solange die Bezugsperson in der Nähe ist. Das führt aber leider oft dazu, dass diesem emotionalen Problem häufig nicht die Bedeutung beigemessen wird, die es im Grunde bräuchte. Je länger die emotionale Störung mit Trennungsangst besteht, desto gravierender ist sie!
Ursachen und Risikofaktoren
Für eine Trennungsangsterkrankung gibt es keinen eindeutigen Auslöser. Vielmehr sehen Experten die Störung als das Ergebnis komplexer Wechselwirkungen zwischen dem kindlichen Temperament und seiner Umwelt an.
Besonders empfindsame und zurückgezogene Kinder haben ein erhöhtes Risiko, frühkindliche, starke Ängste auszubilden. Viele der betroffenen Kinder fremdeln auch sehr stark – und das schon sehr früh!
Auch ein überbehütender Erziehungsstil wird von Experten als mögliche Ursache für eine solche emotionale Störung angesehen: Hiermit unterstützen Eltern ihre ängstlichen Kinder dabei, furchteinflößende Situationen zu meiden. Dadurch kann der Nachwuchs gar nicht erst erlernen, das Alleinsein auch mal auszuhalten.
Auch traumatische Lebenserfahrungen wie etwa der Verlust einer nahestehenden Bezugsperson oder anderer Familienangehöriger sind mögliche Auslöser einer Trennungsangsterkrankung.
Ebenso werden belastende Ereignisse wie Ablehnung im frühen Kindesalter, der Tod eines Haustiers oder ein Umzug als mögliche Ursachen angesehen. Angstgefühle können auch genetisch veranlagt sein.
Therapie
Besonders wirkungsvoll ist eine Verhaltenstherapie, denn hier erlernen die Kleinen schrittweise die Trennung von Bezugspersonen. Sie verinnerlichen, dass sie stark genug sind, auch mal allein zu sein und es ohne die Eltern zu schaffen. Rund drei Viertel der betroffenen Kinder können auf diese Weise ihre emotionale Störung lösen.
Verhaltenstherapie
Eltern bzw. primäre Bezugspersonen spielen in der Verhaltenstherapie eine besonders wichtige Rolle. So müssen sie zum Beispiel selbst erst lernen, die Abschiede zu ihrem Kind möglichst kurz zu gestalten und auf negative Abschiedsreaktionen ihres Kindes möglichst nüchtern zu reagieren.
Das Hauptziel der Behandlung ist, eine normale Teilnahme des Kindes am Kindergarten- und Schulprogramm zu ermöglichen. Dafür müssen alle Beteiligten, also die Eltern, das Kindergarten- bzw. Schulpersonal sowie die Kindertherapeuten als Team zusammenarbeiten. Für das Kind kann es zusätzlich sehr wertvoll sein, auch zu einer anderen Betreuungsperson in Kita oder Schule eine Bindung aufzubauen. Eltern und Bezugspersonen sollten ihr Kind hierbei unterstützen.
Leidet das Kind unter einer sehr ausgeprägten emotionalen Störung der Trennungsangst, kann es notwendig sein, bestimmte Medikamente zu geben, damit die Angst für die Kleinen verringert werden kann. So kann etwa ein Antidepressivum zum Einsatz kommen, sogenannte Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI). In den allermeisten Fällen von Kindern mit Trennungsangst ist eine Medikamentengabe jedoch nicht erforderlich.
Nach verlängerten Wochenenden oder Ferien neigen einige Kinder zu Rückfällen, da sie sich wieder daran gewöhnt haben, ihre Bezugspersonen permanent um sich zu haben. Aus diesem Grund sollten Eltern auch während solcher Zeiten regelmäßige Trennungsabschnitte einplanen, damit das Kind das phasenweise Alleinsein nicht verlernt.
In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, dass das Kind oder auch die gesamte Familie eine Psychotherapie beginnt.
Was Sie selbst tun können
Es gibt einige Selbstmaßnahmen, die bei der Überwindung von Trennungsängsten hilfreich sein können. Am besten ist es dabei, schrittweise und mit viel Geduld vorzugehen. Machen Sie Ihrem Kind Mut, doch überfordern Sie es bitte nicht. Beobachten Sie Ihren kleinen Schatz aufmerksam, denn auf diese Weise merken Sie schnell, wann des dem Kind mal zu viel sein sollte.
Die Grenze zur Überforderung ist mit Sicherheit immer dann überschritten, wenn das Kind weint. Bleibt es hingegen offen, aufgeschlossen und neugierig, dann ist das in Signal für Sie, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Abschied nehmen und Wiedersehen lassen sich bereits früh gezielt, aber spielerisch fördern, so beispielsweise auf folgende Arten:
Weggehen und wiederkommen
Zeigen Sie Ihrem Kind einen Gegenstand, beispielsweise einen flauschigen Teddy und nehmen Sie ihn dann wieder außer Sichtweite. Taucht der Teddy wenig später wieder auf, so wird die Freude bei Ihrem Kind groß sein. Den meisten Säuglingen zwischen 8 und 12 Lebensmonaten macht dieses Spiel richtig viel Spaß! Die Kleinen lernen auf diese Weise spielerisch, dass Dinge nicht für immer verschwinden, nur weil sie eine Zeit lang nicht sichtbar sind. Gleichzeitig lernen sie, dass ein Wiedersehen Freude macht.
Zu diesen Methoden gehört auch das bewährte „Guck-guck-Spiel“.Tipp:
Binden Sie auch andere Familienmitglieder wie etwa die Großeltern, Freunde oder Nachbarn in das Spiel mit ein. Auf diese Weise gewöhnt sich das Baby an verschiedene fremde Gesichter.Wo bist du?
Verstecken spielen ist ein Klassiker der Kinderzeit und dieses Spiel ist auch aus pädagogischem Blickwinkel sehr wertvoll! Kinder genießen den Nervenkitzel bei diesem Spiel und freuen sie sehr über das Wiederfinden der versteckten Person. Geht das Spiel aber mal zu weit bzw. entwickelt sich beim Kind eine zu große Angst, sollten Sie es abbrechen.
Tipp:
Häufig hilft es am Anfang, wenn sich ein Elternteil zusammen mit dem Kind versteckt, beispielsweise die Mama – der Papa muss dann suchen.Andere Menschen miteinbeziehen
Die Anwesenheit anderer Menschen tut kleinen Kindern sehr gut. Wenn sie anfangs jedoch noch fremdeln, ist es wichtig, andere Mitmenschen nicht aufzuzwingen, sondern geduldig abzuwarten, bis das Kind von sich aus bereit ist, Kontakt aufzunehmen. Sobald es sich an die anderen Menschen gewöhnt hat, wird es auf diese zugehen.Kontakt zu gleichaltrigen Kindern pflegen
Die Lust und die Freude am Spielen ist auch für zurückhaltende, schüchterne Kinder ein toller Antrieb! Eltern sollten daher den Kontakt zu Gleichaltrigen ermöglichen und auf eine angenehme, natürliche Weise fördern.Kleine Abschiedsrituale etablieren
Kleine gemeinsame Rituale wie etwa ein Küsschen oder ein Winken beim Abschied an der Kindergartentür erleichtern vielen Kindern den Abschied.Vertraute Gegenstände mitgeben
Der Lieblingsteddy darf natürlich mit in den Kindergarten gehen! Der Tagesmutter ist nicht nur das Kind, sondern auch der flauschige Hase willkommen. Geben Sie dem Kind vertraute und geliebte Gegenstände mit, denn das vermittelt den Kleinen Sicherheit.
