Störungen des Aminosäurestoffwechsels

Unter die Störungen im Aminosäurestoffwechsel fallen eine Gruppe unterschiedlicher Erkrankungen, die entweder auf einem vererbten Enzymdefekt im Abbau bzw. im Transport von Aminosäuren beruhen oder die Folge einer anderen Erkrankung sind, die für einen Eiweißmangel bzw. eine unausgeglichene Zufuhr von Aminosäuren sorgt. Insgesamt gibt es mehr als 40 bekannte erbliche Aminosäure-Stoffwechselstörungen, so zum Beispiel die Ahornsiruperkrankung oder die Homocystinurie. Die häufigste Störung ist jedoch die Phenylketonurie.
Erfahren Sie hier alles Wichtige zu den Symptomen, den Ursachen und den Therapiemöglichkeiten.
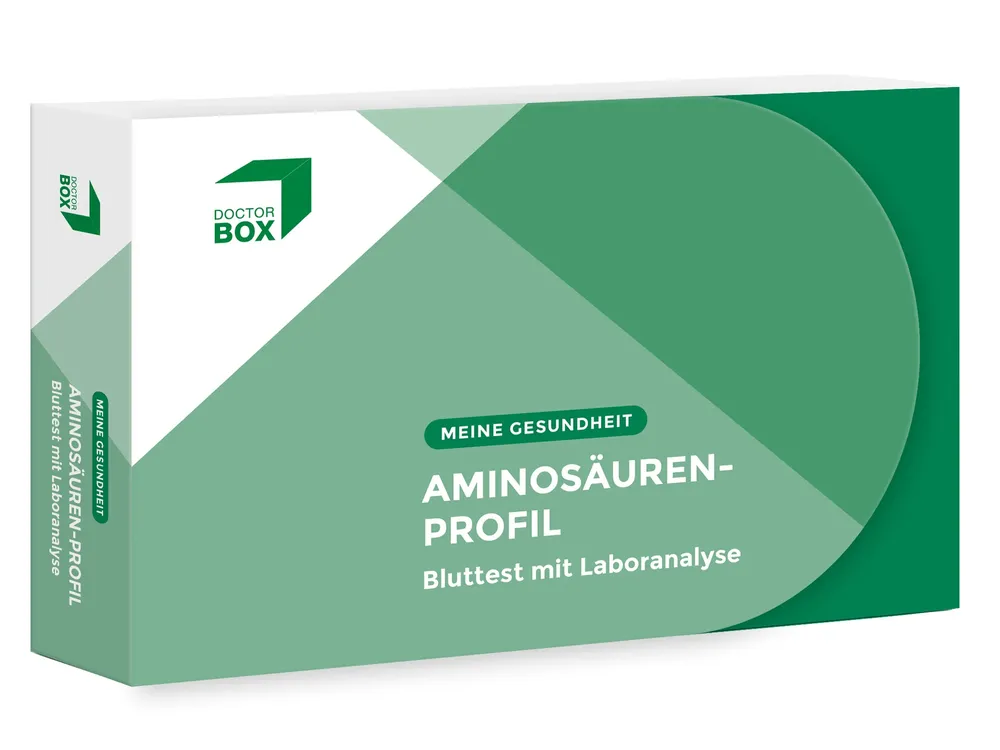
Aminosäuren – ein Lebensgrundbaustein
Aminosäuren sind essenziell wichtige Lebensbausteine: Es handelt sich bei ihnen um lebenswichtige Substanzen, ohne die der menschliche Stoffwechsel keine Proteine zusammenstellen könnte.
Nach dem aktuellen Wissensstand sind mehr als 20 proteinogene Aminosäuren bekannt sowie mehr als 250 Aminosäuren, die als nicht-proteinogen bezeichnet werden: Diese sind nämlich nicht in Proteinen nachweisbar, jedoch im Organismus. Die meisten proteinogenen Aminosäuren kann der Körper des Menschen selbst produzieren. Neun davon jedoch nicht: Sie werden als essenzielle Aminosäuren bezeichnet. Sie müssen dem Körper zwingend über die tägliche Ernährung zugeführt werden.
Doch nicht nur eine Unterversorgung mit Aminosäuren kann gesundheitsschädigend sein, sondern auch eine Überdosierung. Werden dem Körper nämlich über einen längeren Zeitraum Aminosäuren in zu hoher Konzentration zugeführt, so können beispielsweise Organe wie Niere oder Leber darunter leiden.
Obwohl Aminosäuren winzige Strukturen sind, so übernehmen sie im Organismus doch unglaublich vielfältige und lebenswichtige Aufgaben. Diese organischen Säuren sind nämlich die Grundbausteine der Eiweiße. Um ein körpereigenes Protein aufzubauen, verknüpft der menschliche Organismus eine Auswahl der 20 proteinogenen Aminosäuren zu einer Kette. Abhängig von der Kettenlänge ist die Rede von Proteinen oder von Peptiden. Die Kettenlänge und die Positionen der jeweiligen Aminosäuren entscheiden über die Funktion des entstehenden Eiweißes.
Nicht-proteinogene Aminosäuren wie zum Beispiel L-Ornithin, L-Citrullin, L-Thyroxin (gehört zu den Schilddrüsenhormonen) oder GABA (ein Neurotransmitter) sind nicht an der Proteinsynthese beteiligt.
Warum sind Proteine eigentlich so wichtig für den Menschen?
Die Eiweißsynthese und somit auch die Aminosäuren sind für den Menschen von lebensnotwendiger Bedeutung, denn sie übernehmen vielfältige Körperfunktionen: So tragen sie beispielsweise zum Erhalt sowie zur Zunahme der Muskelmasse bei, ebenso zum Erhalt normaler Knochen. Im Organismus finden sich viele verschiedene Proteinarten, die auch unterschiedliche Aufgaben erfüllen:
Sogenannte Transportproteine sorgen für die Weiterleitung wichtiger Stoffe: So transportieren sie zum Beispiel Sauerstoff durch den Organismus.
Strukturproteine gehen den verschiedensten Körperzellen ihre Form.
Speicherproteine sorgen dafür, dass wir Menschen Eisen und andere essenzielle Nährstoffe speichern können und der Organismus bei Bedarf auf diese Speicherdepots auch zurückgreifen kann.
Schutzproteine erfüllen wichtige Funktionen bei der Antikörperbildung und der Blutgerinnung.
Enzyme sind ebenfalls Proteine, die unterschiedliche biochemische Körperreaktionen ermöglichen oder diese beschleunigen.
Hormone werden auch zu den Proteinen gezählt. Sie steuern sämtliche Prozesse des Körpers, so zum Beispiel auch wichtige Stoffwechselvorgänge.
Kurzum: Ohne Aminosäuren würde es keine Körpereiweiße geben und diese sind für das Leben unverzichtbar wichtig.
Essenzielle und nicht-essenzielle Aminosäuren
Zum einen können Aminosäuren über die tägliche Nahrung bzw. über Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden. Jedes Lebensmittel mit einem Eiweißgehalt enthält auch Aminosäuren. Zum anderen kann der Körper manche Aminosäuren selbst synthetisieren (herstellen). So ergibt sich die Klassifikation zwischen essenziellen und nicht-essenziellen Aminosäuren.
Essenzielle Aminosäuren
Isoleucin
Leucin
Methionin
Lysin
Phenylalanin
Threonin
Tryptophan
Valin
Histidin.
Nicht-essenzielle Aminosäuren
Alanin
Arginin
Asparagin
Asparaginsäure
Glutamin
Cystein
Glutaminsäure
Glycin
Prolin
Serin
Tyrosin.
Was ist eigentlich der Aminosäurestoffwechsel?
Der Aminosäurestoffwechsel umfasst im Körper des Menschen alle biochemischen Vorgänge für die Zusammensetzung, die Umwandlung und auch den Abbau von Aminosäuren.
Einige dieser Aminosäuren kann der Körper selbst herstellen und dabei laufen komplexe interne Prozesse ab, bei denen diverse Enzyme und Co-Enzyme genutzt werden. Sind diese nun defekt oder werden sie nur in unzureichender Menge gebildet, kann es zu Störungen im Aminosäurestoffwechsel kommen – was wiederum mit schwerwiegenden Erkrankungen verbunden ist.
Störungen des Aminosäurestoffwechsels
Die meisten Defekte beim Aminosäurestoffwechsel sind angeborene Gendefekte, die vererbt werden. Viele kommen eher selten vor und hängen zudem in ihren Erscheinungsformen davon ab, ob Enzyme in ihrer Funktionsweise gestört sind oder ob sie fehlen.
Die meisten Defekte führen dazu, dass Zwischenprodukte nicht mehr in Aminosäuren umgewandelt werden können. Infolgedessen sammeln sich solche Zwischenprodukte an und gleichzeitig entsteht ein Aminosäuremangel. Es kommt sobald zu Organ- und Gewebeschäden bzw. zu diversen Ausfallerscheinungen.
Der gestörte Aminosäuretransport und der Aminosäureabbau führen zu Erkrankungen wie etwa Albinismus, Homocysteinurie, Ahornsirupkrankheit, Alkaptonurie oder Phenylketonurie.
Beim Albinismus, bei der Alkaptonurie sowie der Phenylketonurie ist der Tyrosin-Stoffwechsel gestört.
Beim Albinismus ist der Körper daher nicht mehr in der Lage, das Hautpigment Melanin zu bilden: Infolgedessen werden die Haut, die Haare und die Augen sehr hell bis nahezu Weiß.
Tyrosin wird durch die Aminosäure namens Phenylalanin gebildet, die über die tägliche Ernährung aufgenommen wird. Fehlt dieses, so kann neben dem Melanin-Hautpigment auch zum Beispiel das Schilddrüsenhormon Thyroxin nicht mehr hergestellt werden.
Bei der Alkaptonurie fehlt das Enzym namens Homogentisinoxigenase, das Homogentisinsäure in Maleylacetessigsäure umwandelt, die dann anschließend über den Urin wieder ausgeschieden wird. Ist dieser Abbauprozess gestört, kommt es zu einer Einlagerung der Maleylacetessigsäure in den Körper: Die Folge sind Entzündungen durch Kalk- und Kristallablagerungen in den Gelenken, Herzfunktionsstörungen oder auch Nierensteine.
Auch der sogenannten Ahornsirupkrankheit liegt ein angeborener Enzymdefekt zugrunde. Hier ist der Abbau der Aminosäuren Isoleucin, Leucin und Valin gestört. Als Folge kommt es zu einer übermäßigen Anreicherung dieser Aminosäuren im Gewebe sowie im Blutkreislauf. Der Urin, über den die Aminosäuren sowie die Umwandlungsprodukte ausgeschieden werden, hat einen ganz eigenen Geruch, von dem die Erkrankung auch ihre Namensbezeichnung erhalten hat.
Die Ahornsirupkrankheit ist auch unter den Namen "MSUD" (Maple Syrup Urine Disease) oder "Leucinose" bekannt. Sie tritt ungefähr bei 1 von 200.000 neugeborenen Babys auf.Bei der klassischen Verlaufsform dieser Erkrankung werden die Neugeborenen ungefähr ab dem vierten Lebenstag apathisch, lethargisch und erkennbar schläfrig. Sie weisen eine deutlich ausgeprägte Trinkschwäche auf, neigen vereinzelt sogar zum Erbrechen und zeigen abgeschwächte Reflexe bzw. eine verminderte Muskelspannung auf.
Im weiteren Krankheitsverlauf kann es dann zu Krampfanfällen, zu akuten Atemantriebstörungen und sogar zum Koma kommen.
Die Behandlung der Ahornsirupkrankheit besteht aus einer Ernährungstherapie. Ohne diese diätetischen Maßnahmen würden die betroffenen Säuglinge schon nach den ersten Lebenswochen infolge der Schäden des zentralen Nervensystems sterben. Die Therapie besteht vor allem aus der konsequenten lebenslangen Vermeidung der Lebensmittel, die die Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin enthalten. Das umfasst einen insgesamt reduzierten Proteingehalt der Nahrung. Während der Fläschchen-Zeit gibt es für die Neugeborenen diätetische Fertigprodukte, die mit abgekochtem Wasser angerührt werden.
Auch die Phenylketonurie gehört zu den Aminosäure-Stoffwechselstörungen. Sie ist sogar die am häufigsten vorkommende Störung.
Das passiert bei der Phenylketonurie (PKU)
Insgesamt gibt es mehr als 40 bekannte erblich bedingte Aminosäurestoffwechselstörungen. Die häufigste von ihnen ist die Phenylketonurie: Hier liegt ein Defekt des Enzyms Phenylalaninhydroxylase vor, das für die Umwandlung von Phenylalanin in Tyrosin zuständig ist. Kann dieser Umwandlungsvorgang nicht stattfinden, so lagert sich Phenylalanin im Gewebe sowie im Blutkreislauf ab und es kommt zu einer Schädigung des Gehirns.
Infolgedessen wird die gesamte körperliche Entwicklung negativ beeinflusst und verzögert. Bei den Betroffenen kann es zu Krampfanfällen sowie zu einer geistigen Behinderung kommen.
Auch für diese Aminosäurestoffwechselstörung gibt es eine spezielle Diät-Ernährungstherapie, die vor allem in den ersten beiden Lebensmonaten neugeborener Kinder maßgeblich zu einer normalen Entwicklung beiträgt.
Medizinerinnen und Mediziner unterschieden unterschiedliche Ausprägungsformen der Phenylketonurie:
Phenylketonurie
Milde Hyperphenylalaninämie
Atypische Phenylketonurie
Die milde Hyperphenylalaninämie ist eine eher selten vorkommende Form der Phenylketonurie, die auf sogenannt autosomal-rezessive Weise vererbt wird: Das bedeutet, dass beide Elternteile den defekten Genabschnitt an das Kind weitervererben müssen, um die Erkrankung auszulösen.
Das Enzym Phenyl-Alanin-Hydroxylase (PAH) wird zwar gebildet, hat aber nur eine sehr geringe Aktivität und kann auch nur wenig Phenylalanin umwandeln. Die Krankheitssymptome fallen dementsprechend mild aus.
Bei der atypischen Form handelt es sich um einen Tetrahydrobiopterin-Mangel. Auch diese Krankheitsform ist autosomal-rezessiv vererbbar, doch hier ist nicht das PAH-Enzym betroffen. Vielmehr besteht hier ein Mangel des Co-Faktors Tetrahydrobiopterin, der indirekt für den Aminosäureabbau erforderlich ist.
Dieser Co-Faktor ist darüber hinaus noch an anderen Stoffwechselvorgängen beteiligt, so beispielsweise an der Dopamin- und Serotoninsynthese. Eine atypische PKU verläuft daher im Allgemeinen schwerer und ist auch mit neurologischen Symptomen verbunden.
Im ICD-10, dem internationalen Krankheitsverzeichnis, finden sich die Störungen des Aminosäurestoffwechsels im Kapitel "Stoffwechselstörungen" unter den Nummern E70.0-E72.9.
Symptome
Zunächst einmal zeigen sich bei Säuglingen mit einer Phenylketonurie keine Symptome. Erst zwischen dem vierten und dem sechsten Lebensmonat machen sich die ersten Probleme bemerkbar, wenn die Erkrankung der Babys bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkannt und adäquat therapiert wurde. Insbesondere die gestörte Gehirnreifung verursacht im weiteren Krankheitsverlauf starke Komplikationen.
Die Krankheitssymptome einer nicht behandelten PKU sind:
Starker geistlicher Entwicklungsrückstand: Der Gehirnschaden schreitet bis zu Pubertät immer weiter voran und stagniert dann plötzlich. In den meisten Fällen sind die betroffenen Kinder geistig schwer behindert.
Epileptische Krampfanfälle: Die Gehirnschädigung führt dazu, dass die Hirnnervenzellen besonders empfindlich und übererregbar sind. Infolgedessen kann es häufig zu epileptischen Anfällen kommen.
Auch die Muskulatur der betroffenen Patientinnen und Patienten ist übererregbar. Die Muskeln verspannen sich krampfartig (spastische Zustände) und das führt zu verschiedenen motorischen Behinderungen und Bewegungsstörungen.
Verhaltensstörungen: Einige Kinder, die an einer Phenylketonurie leiden, sind hyperaktiv und auch ungewöhnlich aggressiv. Auch Wutausbrüche kommen des Öfteren vor.
Mikrozephalie: Aufgrund der nicht ordnungsgemäß ablaufenden Hirnentwicklung bleibt das Wachstum des Kopfes zurück. Der geringe Kopfumfang fällt insbesondere bei älteren Kindern im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen auf.
Auffälliger Geruch: Im Fall einer Phenylketonurie entstehen diverse Abbauprodukte der Aminosäure Phenylalanin, die an den Geruch von Mäuse-Kot erinnern. Diese Abbaustoffe werden vor allem im Urin, jedoch auch über den Hautschweiß ausgeschieden.
Ekzemartige Veränderungen der Haut.
Im Fall einer Phenylketonurie ist zudem die Melanin-Produktion gestört. Der Farbstoff ist vor allem für die Haut- und Augenfarbe verantwortlich, sodass die PKU zum Teil auch das Aussehen der betroffenen Patientinnen und Patienten beeinflusst.
Aus diesem Grund haben die Betroffenen oftmals eine sehr helle, stark sonnenempfindliche Haut sowie blond-weißes Haar. Auch die Regenbogenhaut der Augen, die sogenannte Iris, ist hellblau bis nahezu transparent und lässt den rötlichen Augenhintergrund deutlich durchscheinen.
Diese Symptome einer Phenylketonurie sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Der Hauptgrund hierfür ist vor allem die Aktivität des Enzyms Phenyl-Alanin-Hydroxylase (PAH), das bei jeder und jedem Betroffenen unterschiedlich stark eingeschränkt ist. Während bei einigen Menschen noch eine Restenzymaktivität besteht und sich somit keine zu großen Phenylalanin-Mengen im Körper ansammeln, zeigt sich bei anderen Personen gar keine Enzymaktivität mehr. Dementsprechend schreitet bei ihnen die Erkrankung schneller und auch schwerer voran.
Verlauf
Eine Phenylketonurie (PKU) ist eine nicht heilbare Erkrankung. Bei einer frühzeitigen Diagnose lässt sich jedoch ein schlimmer Krankheitsverlauf verhindern, sodass die betroffenen Patientinnen und Patienten ein nahezu normales Leben führen können.
Von besonderer Bedeutung ist eine strenge phenylalaninarme Diäternährung in der Kindheit während der Gehirnentwicklung. Im Erwachsenenalter können die strengen diätetischen Vorgaben dann häufig ein wenig gelockert werden.
Dennoch müssen die Betroffenen lebenslang diszipliniert auf Ihre Ernährung achten.
Ursachen und Risikofaktoren
Im Fall einer Phenylketonurie ist die Aktivität des Enzyms Phenyl-Alanin-Hydroxylase (PAH) nicht vorhanden bzw. deutlich eingeschränkt. Die Ursache hierfür ist ein Fehler in der Enzymerbinformation.
Bei gesunden Menschen wandelt das PAH-Enzym die Aminosäure Phenylalanin, die aus der Nahrung aufgenommen wird, in die Aminosäure Tyrosin um. Bei Phenylketonurie-Patientinnen und Patienten funktioniert dieser Umwandlungsprozess nicht mehr bzw. nur eingeschränkt.
Infolgedessen kommt es zu einer übermäßigen Ansammlung von Phenylalanin im Gehirn sowie im Blutkreislauf. Auch über den Urin wird die Aminosäure Phenylalanin vermehrt ausgeschieden. Zu hohe Mengen haben aber schädliche Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Ohne eine entsprechende Therapie führt dieser Aminosäurestoffwechselstörung zu einer starken Beeinträchtigung der Gehirnentwicklung.
Bei der Phenylketonurie handelt es sich um eine angeborene Aminosäurestoffwechselstörung, also konkret um eine Erbkrankheit. Rund eines von etwa 10.000 neugeborenen Babys erkrankt hierzulande an dieser Aminosäurestoffwechselstörung. Insgesamt betrachtet kommt die PKU aber eher selten vor.
Betroffene Personen können ihrerseits wiederum die defekte Erbinformation, also das defekte PAH-Gen, an ihre Kinder weitervererben. Das Kind entwickelt die Stoffwechselstörung allerdings nur dann, wenn sowohl die Mutter wie auch der Vater das defekte Gen in sich tragen und an das Kind weitergeben. Diese Art der Vererbung wird in der Medizin als autosomal-rezessiv bezeichnet.
Wenn nur eines der Elternteile den Enzymdefekt weitergibt, so treten beim Kind später keine Symptome auf. Das Kind ist dann aber selbst Trägerin bzw. Träger der Erbinformation und kann den Gendefekt später an die eigenen Kinder weitervererben.
Grundsätzlich besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass das Kind von beiden Elternteilen die gesunde, nicht beschädigte Genvariante erbt.
In einem solchen Fall kommt es zu keinerlei Symptomen und das Kind ist selbst auch keine Trägerin bzw. kein Träger des Gendefekts.
Therapie
Eine strenge proteinarme Diät ist die wichtigste Therapiemaßnahme der Phenylketonurie.
Die essenzielle Aminosäure Phenylalanin kann vom Körper nicht selbst gebildet werden, sondern muss über die Nahrung zugeführt werden. Bei der Aufnahme von Phenylalanin ist es jedoch sehr wichtig, dass kein Überschuss entsteht, denn der Organismus ist in einem solchen Fall nicht in der Lage, diesen wieder abzubauen. Es sollten also nur die Mengen der essenziellen Aminosäure aufgenommen werden, die der Körper auch benötigt.
Diese Aminosäure kommt in fast jedem Protein vor, deswegen sollte die Zufuhr lebenslang kontrolliert werden, um einen Überschuss zu vermeiden.
Folgende Lebensmittel sind während der eiweißarmen Diät verboten:
Fleisch
Wurstwaren
Fisch
Meeresfrüchte
Hülsenfrüchte, wie etwa Kichererbsen, Bohnen, Erbsen, Linsen oder Soja
Getreideprodukte wie Nudeln, Reis oder Brot
Milch und Milchprodukte (Insbesondere bei Säuglingen muss darauf geachtet werden, dass auch Muttermilch – wenn überhaupt – nur in sehr geringen Mengen gegeben werden darf).
In zahlreichen Light-Produkten und zuckerfreien Getränken steckt zudem der Süßstoff Aspartam. Auch dieser ist bei Menschen, die unter einer PKU leiden, tabu, da er zu großen Teilen aus Phenylalanin besteht.
Um aber auch einer Mangelversorgung mit Phenylalanin vorzubeugen, sollten die Patientinnen und Patienten täglich ein Aminosäuregemisch zu sich nehmen, dass zudem noch Mineralstoffe und Vitamine enthält.
BH4-Gabe bei einer Phenylketonurie
Besteht bei den betroffenen Patienten noch eine Restenzymaktivität, so gibt es die Möglichkeit, diese PAH-Aktivität durch die Gabe von BH4 zu fördern. Dadurch soll bei den betroffenen Patientinnen und Patienten die Toleranz für das aufgenommene Phenylalanin erhöht werden. Unter Umständen können dann sogar die Diätvorgaben ein wenig gelockert werden.
Dieses Medikament zur Therapie einer Phenylketonurie ist jedoch erst ab dem vierten Lebensjahr zugelassen.
Im Fall einer atypischen Phenylketonurie wird das fehlende Coenzym BH4 künstlich ersetzt, ebenso bestimmte Botenstoffe wie Serotonin und Dopamin. In einigen Fällen müssen die Betroffenen lebenslang eine phenylalanin-arme Diät einhalten.
Phenylketonurie bei schwangeren Frauen
Schwangere Frauen, die unter einer PKU leiden, sollten folgende Regeln beachten:
Eine proteinarme Diät muss besonders streng eingehalten werden, ansonsten kann das Ungeborene Schaden nehmen und im schlimmsten Fall kann es zu einer Fehlgeburt kommen.
Die Blutwerte sollten regelmäßig ärztlich überprüft werden. Die europäischen Leitlinien empfehlen in einem solchen Fall zwei wöchentliche Messungen der Phenylalanin-Blutwerte. Nicht nur das Gehirn des Babys kann bei einem Phenylalanin-Überschuss geschädigt werden, sondern auch das Herz und die Augen. Auch Fehlbildungen am Skelett sind möglich.
Frauen mit Kinderwunsch sollten ihre Schwangerschaft gründlich planen und auch alle wichtigen Untersuchungen regelmäßig wahrnehmen.
Für eine reibungslos verlaufende Schwangerschaft ist es wichtig, dass die werdenden Mütter sich von der behandelnden Ärztin oder dem Arzt anleiten lassen.
Das können Sie selbst tun
Da es sich bei dieser Aminosäurestoffwechselstörung um eine Erbkrankheit handelt, gibt es keine Möglichkeiten der Prävention. Wer an PKU erkrankt ist, kann aber durch eine strenge Diät, bestehend aus phenylalanin-armen Lebensmitteln, unerwünschten Komplikationen und Krankheitsbeschwerden vorbeugen.
Bei der klassischen Phenylketonurie liegt der Fokus also auf einer lebenslangen veganen Ernährung ohne die Phenylalanin-Quelle Aspartam. Neugeborene Babys werden ausschließlich mit phenylalanin-freier Fläschchen-Nahrung ernährt. Als Beikost sind Gemüse- und Obstmahlzeiten geeignet. Eltern von betroffenen Babys müssen den Phenylalanin-Gehalt aller Speisen exakt berechnen und die von der behandelnden Ärztin oder dem Arzt genannten Grenzwerte konsequent einhalten.
Später wird die Babynahrung dann durch ein Eiweißpulver ersetzt, das speziell für diese Stoffwechselerkrankung entwickelt wurde. Diese Aminosäure-Mischung muss von den Patientinnen und Patienten jeder Mahlzeit zugesetzt werden. Sie ist für das gesamte Leben der Hauptbestandteil der medizinisch erforderlichen phenylalanin-armen Ernährungsweise.
Zudem ist es sehr ratsam, bereits das Kleinkind spielerisch an den Pulvergeruch und den Geschmack zu gewöhnen.
Heutzutage gibt es ein breit gefächertes Angebot an Schulungen und Kochkursen für Betroffene aller Altersstufen. Diese pädagogischen Maßnahmen sprechen vor allem die Eigenverantwortlichkeit der Patientinnen und Patienten an. Gleichzeitig wird ein positiver Umgang mit den ernährungsbedingten Einschränkungen unterstützt.
Auch phenylalanin-arme Fertigprodukte sind erhältlich, die vor allem kleinen Patientinnen und Patienten die Teilnahme an Klassenfahrten und Ausflügen ermöglichen.
Eltern erkrankter Kinder sind großen organisatorischen und auch starken psychischen Belastungen ausgesetzt. Um diesen Leidensdruck zu verarbeiten, können die Teilnahme und der Austausch mit anderen Betroffenen in Selbsthilfegruppen sehr hilfreich sein.
Erwachsene Patientinnen und Patienten müssen die Familienplanung mit besonders großer Sorgfalt angehen. Vor allem in der Schwangerschaft sind strenge Diätvorgaben einzuhalten, um normale Phenylalanin-Werte sicherzustellen. Normalwerte sind aber bereits zum Zeitpunkt der Kindszeugung zwingend erforderlich, um schwerwiegende vorgeburtliche Schäden zu vermeiden.
https://flexikon.doccheck.com/de/Phenylketonurie
https://lexikon.stangl.eu/11364/phenylketonurie
©envatoelements_drazenphoto
